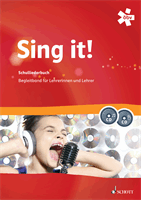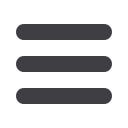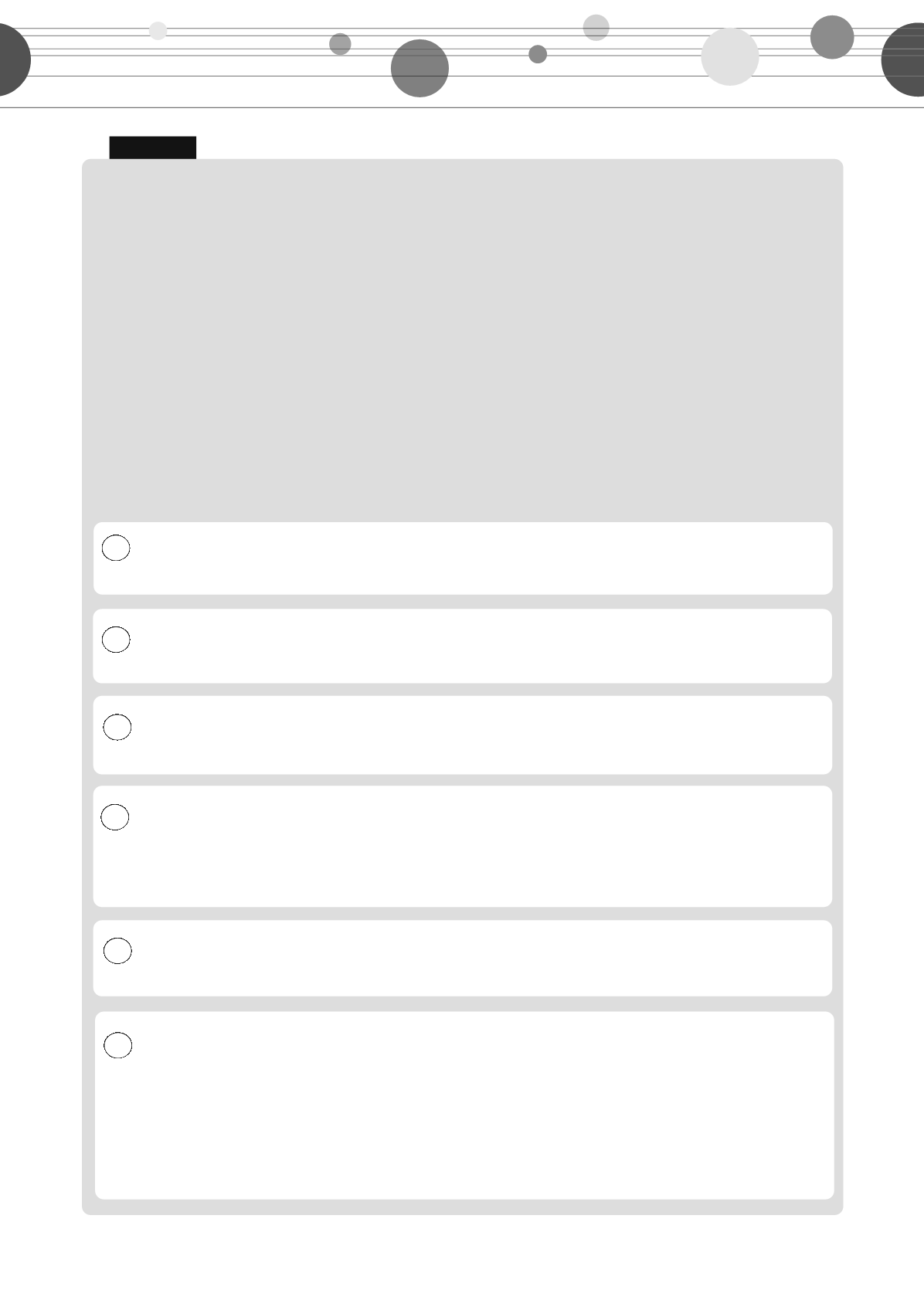
Info
68
Abschlussprojekt: Musikalische Analyse
Arbeitsblatt
Musikalische Analyse
Bei einer musikalischen Analyse werden die formalen, rhythmischen, melodischen und harmonischen Merkmale sowie der
Hintergrund eines Musikstücks untersucht, um einen besseren Einblick in die Komposition zu erhalten und zu ergründen,
wie eine bestimmte Wirkung erreicht wird.
Bei einer musikalischen Analyse ist Folgendes zu beachten:
■
Die Merkmale des Werks sollen nicht nur beschrieben sondern auch auf ihre Bedeutung für die Aussage des Stücks
untersucht werden.
■
Ein Teil der musikalischen Analyse besteht aus der objektiven (= sachlichen) Beschreibung von Merkmalen, der andere
Teil begründet sich auf Vermutungen. Dies sollte man an der Art der Formulierung erkennen.
■
Alle Aussagen sollten durch die Angabe der entsprechenden Taktzahlen am Notentext belegt werden. Oft ist es für die
Darstellung der Analyse sinnvoll, die Verteilung der einzelnen Takte in den abgedruckten (Lied-)Zeilen zu durchbrechen und
die Takte anders aufzuteilen.
Gliederung einer Analyse
Hier wird der Gesamteindruck des Stücks beleuchtet. Dazu gehören die musikalischen Gestal-
tungsmittel (wie z. B. Tempo und Instrumentation) sowie Informationen über Komponisten und
Interpreten eines Stücks.
Dieser Aspekt beinhaltet den Aufbau des Stücks und der einzelnen Formteile. Sie werden meistens
mit Buchstaben bezeichnet. Gebräuchliche Längen der Formteile sind 4, 8 oder 16 Takte. Es gibt
aber auch Kompositionen, die absichtlich gegen diese üblichen Größen verstoßen.
In diesem Bereich wird das Stück auf seine Taktart, die verwendeten Notenwerte und rhythmische
Auffälligkeiten (z. B. häufig auftretende rhythmische Grundbausteine) untersucht. Die einzelnen
Teile der Komposition sollten in ihrer Rhythmik untereinander verglichen werden.
Tonlage, Tonumfang und die auffällige Verwendung bestimmter Intervalle gehören in diesen Teil
der Analyse. Melodieverläufe, wie z. B. sich wiederholende Melodieteile und gleiche Motive auf
verschiedenen Tonhöhen werden auch im Hinblick auf den Textinhalt und die Textverteilung
analysiert. Untersucht wird auch die Verwendung von Artikulationszeichen, wie z. B. legato (=
gebunden), staccato (= kurz) oder portato (= breit).
Hier geht es um die Tonart, die Verwendung und Verteilung der Akkorde (evtl. mit Angabe der
Stufen). Die Wahl der Akkorde sollte auch auf ihren Zusammenhang mit dem Text untersucht
werden – z. B. die Verwendung von Dur und Moll.
Gemeint sind hier einzelne Lautstärkestufen (z. B. piano oder forte) aber auch die Zu- und Ab-
nahme der Lautstärke (crescendo, decrescendo). Sind keine Dynamiksymbole eingetragen, muss
der Musiker selbst eine dynamische Umsetzung finden. Das bezeichnet man als Interpretation.
Sie unterliegt trotz „künstlerischer Freiheit“ bestimmten Regeln:
■
Am Ende eines Formteils geht die Lautstärke in der Regel zurück.
■
Kontraste zwischen laut und leise an geeigneten Stellen beleben ein Stück zusätzlich, z. B.
durch Veränderung der Lautstärke bei Wiederholungen.
■
Die Dynamik sollte zum Text passen.
Allgemeines
1.
2.
Form
3.
Rhythmik
4.
Melodik
5.
Harmonik
6.
Dynamik
Nur zu Prüfzwecken –
Eigentum des Verlag öbv